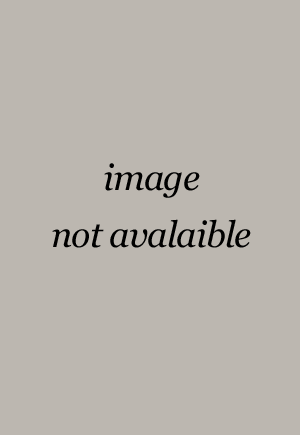(To see other currencies, click on price)
MORE ABOUT THIS BOOK
Contents:
1 Bedeutung und Aufgaben der Psychosozialen Medizin.- 1.1 Was ist Psychosoziale Medizin?.- 1.2 Wandel der Medizin.- 1.3 Ziele der Medizin.- 1.4 Gesundheits- und krankheitsrelevante Faktoren.- 1.5 Stellung der Psychosozialen Medizin im medizinischen Ausbildungscurriculum.- 1.6 Konzeption der medizinischen Ausbildung.- Literatur.- 2 Medizinstudierende und Medizinstudium.- 2.1 Wer studiert Medizin?.- 2.2 Belastungen und Ressourcen im Studium.- 2.3 Studienerfolg.- 2.4 Studienreform.- Literatur.- 3 Die AErztin / Der Arzt.- 3.1 Arztberuf im Wandel der Zeit.- 3.2 Berufsbild - Spezialisierung - Interdisziplinaritat.- 3.3 Geschlechtstypische Rollenbilder und Karrieremuster.- 3.4 Karriereberatung und -foerderung.- 3.5 Mentoring und berufliche Netzwerke.- 3.6 Stressoren und Gesundheitsrisiken von AErztinnen und AErzten.- Literatur.- 4 Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Medizin.- 4.1 Allgemeine wissenschaftstheoretische Grundlagen.- 4.2 Theoriebildung in der Medizin.- 4.3 Quantitative und qualitative Forschung in der Medizin.- Literatur.- 5 Psychische Grundfunktionen.- 5.1 Biologische Grundlagen psychischer Funktionen.- 5.2 Psychische Grundfunktionen im Einzelnen.- 5.3 Kognition, Emotion und Verhalten in der arztlichen Praxis.- Literatur.- 6 Grundlagen des Sozialverhaltens.- 6.1 Biologische und evolutionare Grundlagen.- 6.2 Soziale Kognition.- 6.3 Rollentheorie.- 6.4 Kommunikation.- 6.5 Soziale Kompetenz.- 6.6 Soziale Unterstutzung.- 6.7 Psychologie von Kleingruppen.- 6.8 Soziale Schichtung.- 6.9 Soziale Krisen.- Literatur.- 7 Soziale Systeme und ihre Regelung.- 7.1 Historische Wurzeln des systemischen Denkens.- 7.2 System - Definition des Begriffes.- 7.3 Systemtheorie - Ansatze und Konzepte.- 7.4 Strukturelle Merkmale sozialer Systeme.- 7.5 Funktionsprinzipien.- 7.6 Steuerung sozialer Systeme.- 7.7 Qualitatsfoerderung im Gesundheitswesen.- 7.8 Die Bedeutung des Systemdenkens fur die Medizin.- Literatur.- 8 Entwicklungspsychologie.- 8.1 Entwicklungspsychologische Grundlagen und Theorien.- 8.2 Schwangerschaft und Geburt.- 8.3 Neugeborenenzeit.- 8.4 Sauglings- und Kleinkindalter.- 8.5 Kindergarten- und Schulalter.- 8.6 Jugendalter - Pubertat und Adoleszenz.- 8.7 Interaktionelles Modell der Entwicklung.- 8.8 Entwicklung des Erwachsenen.- 8.9 Frau und Mann.- 8.10 Paarbeziehungen.- 8.11 Familienbeziehungen.- 8.12 Das Alter.- 8.13 Sterben und Tod.- Literatur.- 9 Persoenlichkeitspsychologie.- 9.1 Was ist Persoenlichkeit?.- 9.2 Paradigmen der Persoenlichkeitspsychologie.- 9.3 Das Eigenschaftsparadigma.- 9.4 Das psychoanalytische Paradigma.- 9.5 Das behavioristische Paradigma.- 9.6 Humanistische und interaktionistische Theorien.- 9.7 Persoenlichkeitsmodelle im Vergleich.- 9.8 Persoenlichkeit im interkulturellen Vergleich.- 9.9 Persoenlichkeitsstoerungen.- Literatur.- 10 Psychologische Testverfahren.- 10.1 Anwendungsfelder, Aufgaben und Stellenwert psychologischer Testdiagnostik.- 10.2 Definition, Testkonstruktion und Testgutekriterien.- 10.3 Klassifikation von Testverfahren.- 10.4 Beispiele psychologischer Tests.- Literatur.- 11 Gesundheitsrelevante Lebensstile.- 11.1 Sozialwissenschaftliche Begriffsdefinition.- 11.2 Theoretischer Bezugsrahmen des Konzeptes.- 11.3 Determinanten gesundheitsrelevanter Lebensstile.- 11.4 Lebensstil-Konzept und arztliche Praxis.- Literatur.- 12 Gesundheit und Krankheit.- 12.1 Gesundheitsmodelle, Krankheitsmodelle.- 12.2 Salutogenese - Pathogenese.- 12.3 Gesundheitsfoerderung und Pravention.- 12.4 Gesundheits- und Risikoverhalten.- Literatur.- 13 Die Arzt-Patient-Beziehung.- 13.1 Rahmenbedingungen und Determinanten.- 13.2 Die Arzt- und Krankenrolle.- 13.3 Interaktion in der Arzt-Patient-Beziehung.- 13.4 Plazeboeffekte.- 13.5 Sexuelle Belastigung in der Arzt-Patient-Beziehung.- 13.6 Schwierige Arzt-Patient-Beziehungen.- 13.7 Interaktion Arzt-Patient-Familie.- Literatur.- 14 Geschlechterfragen in der Medizin.- 14.1 Bedeutung des Geschlechtes fur die Medizin.- 14.2 Krankheiten von Mannern und Krankheiten von Frauen?.- 14.3 Wahrnehmung und Interpretation.- 14.4 Geschlechtsmerkmale der Kommunikation im medizinischen Setting.- 14.5 Geschlechterdifferentes arztliches Handeln.- Literatur.- 15 Das arztliche Gesprach - die arztliche Untersuchung.- 15.1 Schwierigkeiten in der Arzt-Patient-Kommunikation.- 15.2 Zielsetzungen und Aufbau eines Anamnesegespraches.- 15.3 Die Patientin/der Patient als "terra incognita".- 15.4 Konkrete Gesprachstechniken.- 15.5 Besondere Gesprachssituationen.- 15.6 Das Mitteilen schlechter Nachrichten.- 15.7 Das Beratungsgesprach.- 15.8 Psychologische Aspekte der Koerperuntersuchung.- 15.9 Die arztliche Untersuchung von Kindern.- 15.10 Die Untersuchung von Adoleszenten.- Literatur.- 16 Subjektive Krankheitskonzepte - Krankheitsbewaltigung.- 16.1 Subjektive Krankheitstheorien und Gesundheitsvorstellungen.- 16.2 Psychosoziale Belastungen einer Krankheit - Krankheitsbewaltigung.- 16.3 Einflussfaktoren auf die Krankheitsbewaltigung.- 16.4 Krankheitsbewaltigung und das Stress-Konzept.- 16.5 Bewaltigung als Prozess.- 16.6 Ziele der Krankheitsbewaltigung.- Literatur.- 17 Gesundheitsbezogene Lebensqualitat.- 17.1 Historische Entwicklung.- 17.2 Lebensqualitat und Qualitatssicherung.- 17.3 Definitionen und Konzepte.- 17.4 Theoretische Grundlagen der Lebensqualitatsforschung.- 17.5 Klinische Befunde zur Lebensqualitat.- 17.6 Offene Fragen in der Lebensqualitats-Forschung.- Literatur.- 18 Psychophysiologie.- 18.1 Psychophysiologische Prozesse.- 18.2 Psychophysiologie der Affekte und Emotionen.- 18.3 Stress aus psychosozialer Sicht.- 18.4 Psychophysiologie der Blutgerinnung.- 18.5 Essen und Verdauung.- 18.6 Sexualitat.- 18.7 Schlaf 484.- 18.8 Koerperwahrnehmung und Koerperbild.- 18.9 Entspannungsverfahren.- Literatur.- 19 Psychosomatische und somatopsychische Stoerungen.- 19.1 Wurzeln psychosomatischer Krankheitskonzepte.- 19.2 Das integrative biopsychosoziale Modell.- 19.3 Psychosomatisch-somatopsychische Wechselwirkungen.- 19.4 Psychosomatisch-somatopsychische Wechselwirkungen am Beispiel der somatoformen Stoerungen.- 19.5 Somatopsychisch-psychosomatische Wechselwirkungen am Beispiel kardiovaskularer Erkrankungen.- 19.6 Somatopsychisch-psychosomatische Wechselwirkungen am Beispiel onkologischer Erkrankungen.- 19.7 Konsequenzen fur die psychosomatische Diagnostik und Mitbehandlung von Patientinnen mit koerperlichen Erkrankungen.- Literatur.- 20 Rehabilitation.- 20.1 Behinderung und chronische Krankheit.- 20.2 Das Krankheitsfolgenmodell.- 20.3 Ziele und Systeme der Rehabilitation.- 20.4 Leistungen der Rehabilitation.- 20.5 Psychologische Rehabilitation.- 20.6 Interdisziplinaritat und Reha-Team.- 20.7 Rehabilitationsforschung und Erfolgsmessung.- 20.8 Ausblick.- Literatur.- 21 Sondersituationen des Krankseins.- 21.1 Notfallsituationen in der Medizin.- 21.2 Akute und chronische Krankheit.- 21.3 Multimorbiditat im Alter.- 21.4 Abhangigkeit.- 21.5 Terminale Krankheit und Sterben.- Literatur.- 22 Informationsmodelle und Informationsstrategien in der Medizin.- 22.1 Kommunikationsmodelle.- 22.2 Informationsstrategien.- 22.3 Gesundheitsfoerdernde Massnahmen.- 22.4 Patientenschulung.- 22.5 Telefonische Beratung und Behandlung.- 22.6 Einfluss des Fernsehens.- 22.7 Telemedizin und E-Health.- 22.8 Ausblick.- Literatur.
PRODUCT DETAILS
Publisher: Springer (Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K)
Publication date: August, 2014
Pages: 598
Weight: 1049g
Availability: Available
Subcategories: Psychiatry, Psychotherapy
From the same series
Wolfram Karges
Georg Lc6ffler
Hermann Lang
Ulrike Ehlert
Mihai Ancau
Werner Hacke
Werner Buselmaier
Marian C. Poetzsch
Theo R Payk
Gerald Rimbach
Jürgen Schatz
Manfred Gey
Thomas Gasser
E Hackenthal
Mary Anne Koda-Kimble
Thomas Luescher
Elke Wild
Ulrich Harten
David G. Myers
Tina Hartmann
Klaus Windgassen
Marcel Verhoff
Thomas Ziegenfuß
Jasmin Webinger
Wolfgang Stroebe
Mark Buchta
Gerhard Heldmaier
Robert F. Schmidt
Jürgen E. Gschwend
Peter C Heinrich
Wolfram Karges
J. Crocker
Thomas Lüscher
Martin W. Schnell
Adalbert Wollrab
Thomas Luescher
Michael P. Manns
Stefan H. E. Kaufmann
Alexander Krämer
Peter Berlit
Steffen Fleßa
Xaver Baur
Berthold Rzany
Wolfgang Uwe Eckart
Veronika Brandstätter
Joachim Hoffmann
Joachim Grifka
Berthold Koletzko
Wolfgang Piper
Johannes Zschocke
Tilman Grune
Peter Zweifel
Franz Petermann
Robert F. Schmidt
Ulrich Hagg-Grun
Gerhard Heldmaier
M. Ackenheil
Herbert Stricker
Ulrike Ehlert
Matthias Berking
Matthias Berking
Werner A Muller
Jorg-Rudiger Siewert
Hans-Otto Karnath
Thomas Lenarz
Werner Buselmaier
Stefan H. E. Kaufmann
Stefan Offermanns
Manfred Amelang
Christian Prinz
Rudolf Klussmann
Fritz K. Beller
Michael Jacobs
Helmut Kindl
Norbert Pallua
Peter Kappeler
Klaus Windgassen
Jürgen Schatz
Nicolai Maass
Peter Walter
Thomas Ziegenfuß
Franz Grehn
Werner Baltes
Rainer Muche
Thomas Gasser
Hans-Ulrich Wittchen
Marcel Verhoff
Christian Reimer
Helmut Klein
Barbel Hacker
Ulrich Harten
Johannes C.G. Ottow
Barbel Hacker
Thomas Lüscher
Jörg B. Schulz
Florian Lang
J.-Matthias Graf von der Schulenburg
Werner Hacke
Jorg-Rudiger Siewert
Hermann Lang
Karl Zilles
Theo R Payk
Wolfgang Hennig
Ulrike Leopold-Wildburger
Richard Hautmann
Gerald Rimbach
Kay Brune
Berthold Koletzko
Norbert Wagner
Stephan Frings
Bernhard Tillmann
Frank Schneider
Gerold Adam
Bernhard Tillmann
Peter Fritsch
Ursus-Nikolaus Riede
Franz-Josef Kretz
Manfred Gey
Hans Peter Latscha
Klaus-Peter W. Schaps
Klaus-Peter W. Schaps
Georg Loffler
Klaus-Peter W. Schaps
Klaus-Peter W. Schaps
Jurgen Bortz
Brigitte Frank
Klaus-Peter W. Schaps
Jürgen Neumann
Klaus-Peter W. Schaps
Josef Rosenecker
Werner Grosch
Klaus-Peter W. Schaps
Ulrich Kattmann
Klaus-Peter W. Schaps
Rolf D. Issels
Klaus-Peter W. Schaps
Christian Hick
Stefan Gr]ne
Nanny Wermuth
Marc Naguib
Walter Jonat
Thomas Efferth
Arnulf Moeller