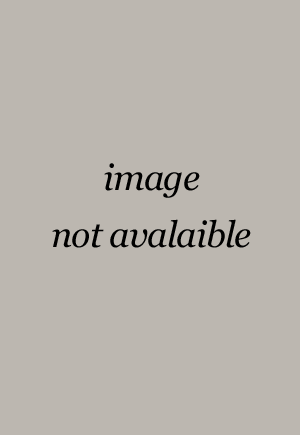(To see other currencies, click on price)
MORE ABOUT THIS BOOK
Feature:
Einziges Lehrbuch für Verhaltensmedizin im deutschsprachigen Raum
Prüfungsrelevantes Wissen für die Klinische Psychologie
Ausgezeichnete Didaktik: Merksätze, Fallbeispiele, Wiederholungsfragen
Back cover:
Verhaltensmedizin = Verhaltenstherapie + Medizin?
Verhaltensmedizin ist mehr als die Anwendung verhaltenstherapeutischer Methoden in der Medizin: Im Mittelpunkt steht das Zusammenspiel von Psyche und Körper. Entstehung und Aufrechterhaltung von Gesundheit und Krankheit werden in dem interdisziplinären Arbeitsfeld unter psychologischer, biologischer und sozialer Perspektive betrachtet.
Verhaltensmedizin spannend, verständlich, umfassend:
- Definitionen und Merksätze kennzeichnen prüfungsrelevantes Wissen,
- zahlreiche Fallbeispiele, Abbildungen und tabellarische Übersichten veranschaulichen komplexe Zusammenhänge,
- Zusammenfassungen und Wiederholungsfragen ermöglichen die Überprüfung des Gelernten. Das Lehrbuch der Verhaltensmedizin - der vollständige Überblick über eine junge Wissenschaft und ein spannendes Arbeitsfeld!
Contents:
Grundlagen der Verhaltensmedizin.- 1 Was ist eigentlich Verhaltensmedizin?.- 1.1 Verhaltensmedizin: Definitionen.- 1.2 Die Wurzeln der Verhaltensmedizin.- 1.3 Die Verhaltensmedizin und ihre Nachbardisziplinen.- 1.3.1 Neurowissenschaften.- 1.3.2 Biologische Psychologie, klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie.- 1.3.3 Psychosomatik und medizinische Psychologie.- 1.4 Wo steht die Verhaltensmedizin heute?.- Zusammenfassung, Wiederholungsfragen und Literatur.- 2 Biologische Grundlagen.- 2.1 Das Nervensystem.- 2.1.1 Aufbau des Nervensystems.- 2.1.2 Neurone, Übertragung von Informationen und Neurotransmitter.- 2.1.3 Das zentrale Nervensystem.- 2.1.4 Das autonome Nervensystem.- 2.2 Das endokrine System.- 2.2.1 Hormone und Rezeptoren.- 2.2.2 Das hypothalamisch-hypophysäre System.- 2.2.3 Psychoneuroendokrinologie.- 2.3 Das Immunsystem.- 2.3.1 Konstitutive Immunität.- 2.3.2 Erworbene Immunität.- 2.3.3 Interaktion zwischen endokrinem System, zentralem Nervensystem und Immunsystem.- 2.3.4 Psychoneuroimmunologie.- 2.4 Verhaltensgenetik.- 2.4.1 Genetische Grundlagen.- 2.4.2 Genetik und Verhalten.- 2.5 Entwicklung über die Lebensspanne.- 2.5.1 Entwicklung des Gehirns und neuronale Plastizität.- 2.5.2 Sexuelle Entwicklung.- 2.5.3 Alter.- 2.6 Chronobiologie.- 2.6.1 Komponenten der zirkadianen Rhythmik.- 2.6.2 Neuronale Grundlagen der zirkadianen Rhythmik.- 2.6.3 Zirkadiane Rhythmen und Rhythmusstörungen.- 2.6.4 Implikationen für Diagnostik und Therapie.- 2.7 Ausblick.- Zusammenfassung, Wiederholungsfragen und Literatur.- 3 Psychologische Grundkonzepte der Verhaltensmedizin.- 3.1 Lernen und Sozialisation.- 3.1.1 Klassische Konditionierung.- 3.1.2 Operante Verstärkung.- 3.1.3 Modelllernen.- 3.1.4 Weitere Sozialisationsaspekte.- 3.2 Informationsverarbeitung und Gedächtnis.- 3.3 Subjektive Krankheitsmodelle.- 3.4 Krankheitsverhalten.- 3.5 Symptomwahrnehmung.- 3.5.1 Interozeption.- 3.5.2 Somatosensorische Verstärkung.- 3.6 Gesundheitsängste.- 3.7 Stress.- 3.8 Emotion.- 3.9 Persönlichkeit.- 3.10 Salutogenetische Aspekte.- 3.11 Belastungs- und Krankheitsbewältigung (Coping).- 3.12 Soziale Unterstützung.- 3.13 Gesundheitsschädigendes Verhalten.- 3.14 Lebensqualität.- 3.15 Compliance und Motivation zur Behandlung.- Zusammenfassung, Wiederholungsfragen und Literatur.- 4 Messmethoden der Verhaltensmedizin — Diagnostik und Evaluation anhand psychologischer und biologischer Parameter.- 4.1 Psychologische Diagnostik.- 4.1.1 Problemanalyse.- 4.1.2 Strukturierte Interviews.- 4.1.3 Fragebogenverfahren.- 4.1.4 Tagebücher.- 4.2 Peripherphysiologische Messmethoden.- 4.2.1 Elektrophysiologische Diagnostik.- 4.2.2 Psychoneuroendokrinologische Diagnostik.- 4.3 Zentralnervöse Messmethoden.- 4.3.1. Elektroenzephalogramm und Magnetenzephalogramm.- 4.3.2 Bildgebende Verfahren.- Zusammenfassung, Wiederholungsfragen und Literatur.- 5 Die Anwendung der Verhaltensmedizin.- 5.1 Wie lässt sich die Vielfalt der verhaltensmedizinischen Anwendungsfelder ordnen?.- 5.2 Annahmen zur Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung oder Erkrankung.- 5.3 Prävention, Intervention und Rehabilitation.- 5.4 Verhaltensmedizin bei verschiedenen Symptomkomplexen physischer und psychischer Auffälligkeiten.- 5.5. Verhaltensmedizin und Versorgungsstrukturen.- 5.6. Spezifität verhaltensmedizinischer Interventionen.- Zusammenfassung, Wiederholungsfragen und Literatur.- Spezifische Anwendungsfelder der Verhaltensmedizin.- 6 Chronische Schmerzsyndrome.- 6.1 Verhaltensmedizinische Perspektive.- 6.2 Epidemiologie.- 6.3 Psychobiologische Grundlagen.- 6.3.1 Physiologie und Pathophysiologie des Schmerzes.- 6.3.2 Psychologische Grundlagen.- 6.3.3 Ein verhaltensmedizinisches Modell.- 6.4 Klinische Schmerzdiagnostik.- 6.4.1 Somatischer Befund.- 6.4.2 Verbal-subjektive Ebene.- 6.4.3 Erfassung von Schmerzverhalten.- 6.4.4 Psychophysiologische Untersuchung.- 6.4.5 Integration und differenzielle Indikation.- 6.5 Therapie chronischer Schmerzen.- 6.5.1 Somatische Verfahren.- 6.5.2 Biofeedback und Entspannungsverfahren.- 6.5.3 Operantes Gruppentraining.- 6.5.4 Kognitiv-verhaltenstherapeutische Schmerzbewältigung.- 6.5.5 Verhaltensmedizinische Therapie.- 6.6 Prävention von chronischen Schmerzen.- 6.7 Ausblick.- Zusammenfassung, Wiederholungsfragen und Literatur.- 7 Herz-Kreislauf-Erkrankungen.- 7.1 Physiologie des kardiovaskulären Systems.- 7.1.1 Elektrische Aktivität des Herzens.- 7.1.2 Hämodynamik und Blutdruck.- 7.2 Kardiovaskuläre Psychophysiologie.- 7.2.1 Hämodynamische Aktivierung durch Stress.- 7.2.2 Physiologie der Herzwahrnehmung (Kardiozeption).- 7.3 Arteriosklerose.- 7.3.1 Koronare Herzkrankheit.- 7.3.2 Arterielle Hypertonie.- 7.3.3 Diabetes mellitus als Risikofaktor für Arteriosklerose.- 7.4 Synkopen.- 7.5 Somatisch nicht erklärbare kardiale Symptome.- Zusammenfassung, Wiederholungsfragen und Literatur.- 8 Atemwegserkrankungen.- 8.1 Asthma bronchiale.- 8.1.1 Definition und Pathophysiologie.- 8.1.2 Epidemiologie.- 8.1.3 Diagnostik.- 8.1.4 Verhaltensmedizinische Behandlung.- 8.2 COPD.- 8.2.1 Definition und Pathophysiologie.- 8.2.2 Epidemiologie.- 8.2.3 Diagnostik.- 8.2.4 Verhaltensmedizinische Behandlung.- Zusammenfassung, Wiederholungsfragen und Literatur.- 9 Störungen des gastrointestinalen Systems.- 9.1 Gibt es eine „Psychologie“ des Verdauungstraktes?.- 9.2 Ulkuskrankheiten.- 9.2.1 Definition und Symptomatik.- 9.2.2 Epidemiologie.- 9.2.3 Ätiologie und Pathogenese.- 9.2.4 Psychosoziale Untersuchungsergebnisse.- 9.2.5 Diagnostik.- 9.2.6 Therapie.- 9.3 Chronisch entzündliche Darmerkrankungen.- 9.3.1 Definition und Symptomatik.- 9.3.2 Epidemiologie.- 9.3.3 Ätiologie und Pathogenese.- 9.3.4 Psychosoziale Faktoren.- 9.3.5 Diagnostik.- 9.3.6 Therapie.- 9.4 Funktionelle Darmerkrankungen.- 9.4.1 Definition und Symptomatik.- 9.4.2 Epidemiologie.- 9.4.3 Ätiologie und Pathogenese.- 9.4.4 Psychosoziale Faktoren.- 9.4.5 Diagnostik.- 9.4.6 Therapie.- 9.5 Stuhlinkontinenz.- 9.5.1 Definition und Symtomatik.- 9.5.2 Epidemiologie.- 9.5.3 Ätiologie und Pathogenese.- 9.5.4 Psychosoziale Aspekte.- 9.5.5 Diagnostik.- 9.5.6 Therapie.- Zusammenfassung, Wiederholungsfragen und Literatur.- 10 Krebserkrankungen.- 10.1 Definition, Klassifikation, klinische Beschreibung und Symptome.- 10.2 Epidemiologie und Verlauf.- 10.3 Ätiologische Konzepte.- 10.3.1 Multifaktorielle Genese von Krebserkrankungen.- 10.3.2 Psychologische Faktoren.- 10.4 Folgeerscheinungen der Diagnose und der Behandlung.- 10.4.1 Begleiterscheinungen der Chemotherapie: Übelkeit und Erbrechen, Immunmodulation und Nahrungsaversion.- 10.4.2 Schmerzen.- 10.4.3 Spezielle körperliche Funktionseinschränkungen.- 10.4.4 Psychische Folgen der Krebsdiagnose und der Behandlung.- 10.5 Diagnostische Methoden.- 10.6 Therapie und Effektivitätsnachweis.- 10.6.1 Aufklärung über Erkrankung und Behandlungsablauf.- 10.6.2 Verhaltenstherapeutische Maßnahmen.- 10.6.3 Supportiv-expressive Gruppentherapie.- Zusammenfassung, Wiederholungsfragen und Literatur.- 11 Dermatologische Erkrankungen.- 11.1 Biologische Grundlagen von Hautkrankheiten.- 11.2 Pathogenese und Symptomatik dermatologischer Störungsbilder.- 11.3 Verhaltensmedizinische Störungsmodelle in der Dermatologie.- 11.3.1 Klassifikation von Störungen.- 11.3.2 Vulnerabilitäts-Stress-Modell psychischer Faktoren bei Hautkrankheiten.- 11.3.3 Probleme in der Krankheitsbewältigung bei Hautkrankheiten.- 11.3.4 Somatoforme Störungen.- 11.3.5 Hautmanipulationen: Kratzen und artifizielle Störungen.- 11.4 Verhaltensmedizinische Diagnostik.- 11.5 Verhaltensmedizinische Behandlung von Hautkrankheiten.- 11.5.1 Neurodermitis.- 11.5.2 Urtikaria.- 11.5.3 Psoriasis vulgaris.- 11.5.4 Acne vulgaris.- 11.5.5 Malignes Melanom.- 11.5.6 Herpes simplex.- 11.5.7 Sklerodermie.- 11.5.8 Alopecia areata.- 11.6 Verhaltensmedizinische Behandlung somatoformer Störungen mit dermatologischen Symptomen.- 11.6.1 Körperdysmorphe Störung.- 11.6.2 Somatoformer Juckreiz und andere somatoforme Hautsymptome.- 11.7 Artifizielle Störungen.- 11.7.1 Hautschädigungen aufgrund von Impulskontrollstörungen.- 11.7.2 Kutane Artefakte (Dermatitis artefacta).- Zusammenfassung, Wiederholungsfragen und Literatur.- 12 Gynäkologie und Geburtshilfe aus einer biopsychosozialen Perspektive.- 12.1 Forschungsschwerpunkte.- 12.2 Sexualität.- 12.2.1 Sexuelle Störungen.- 12.2.2 Psychische Faktoren bei der Entstehung und Aufrechterhaltung sexueller Beschwerden.- 12.2.3 Behandlung sexueller Probleme.- 12.3 Der Menstruationszyklus.- 12.3.1 Menstruelle Zyklusstörungen.- 12.3.2 Einflussfaktoren auf die Menstruation.- 12.3.3 Menstruation und Wohlbefinden: das prämenstruelle Syndrom.- 12.4 Fruchtbarkeitsstörungen und Reproduktionstechnologien.- 12.4.1 Ursachen der Unfruchtbarkeit.- 12.4.2 Psychosoziale Aspekte der Subfertilität.- 12.4.3 Psychische Auswirkungen der Behandlung.- 12.4.4 Psychologische Interventionen.- 12.4.5 Psychische Folgen einer geglückten In-vitro-Fertilisation für Eltern und Kind.- 12.5 Schwangerschaft und perinatale Problematik.- 12.5.1 Schwangerschaft und Wohlbefinden.- 12.5.2 Schwangerschaftskomplikationen.- 12.5.3 Pränatale Diagnostik.- 12.5.4 Psychologische Interventionen und Verlauf der Schwangerschaft.- 12.5.5 Wohlbefinden nach der Schwangerschaft.- 12.6 Die Menopause.- 12.7 Chronische Bauchschmerzen.- Zusammenfassung, Wiederholungsfragen und Literatur.- 13 Immunologische Erkrankungen: Rheuma, Lupus erythematodes und HIV-Infektion.- 13.1 Immunologische Erkrankungen in der Verhaltensmedizin.- 13.2 Rheumatoide Arthritis und systemischer Lupus erythematodes: Beschreibung, Häufigkeit und Ätiologie.- 13.2.1 Häufigkeiten.- 13.2.2 Klinische Bilder.- 13.2.3 Pathophysiologie.- 13.3 HIV-Infektion: Beschreibung, Häufigkeit und Ätiologie.- 13.3.1 Häufigkeit.- 13.3.2 Klinisches Bild.- 13.3.3 Pathophysiologie.- 13.4 Die Neuro-Immun-Interaktion.- 13.5 Stresseffekte auf Immunfunktionen.- 13.5.1 Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse und Immunfunktion.- 13.5.2 Sympathisches Nervensystem und Immunfunktion.- 13.6 Stresseffekte auf Krankheitsverläufe.- 13.6.1 Einfluss psychosozialer Faktoren bei rheumatoider Arthritis und systemischem Lupus erythematodes.- 13.6.2 Einfluss psychosozialer Faktoren bei HIV-Infektion.- 13.7 Interventionsstudien und Verbesserung des Immunstatus.- 13.7.1 Verhaltensinterventionen bei Autoimmunerkrankungen.- 13.7.2 Verhaltensinterventionen bei HIV-infizierten Patienten.- Zusammenfassung, Wiederholungsfragen und Literatur.- 14 Fibromyalgie und chronisches Erschöpfungssyndrom.- 14.1. Historischer und theoretischer Hintergrund.- 14.2 Deskription, Definition und Diagnostik.- 14.2.1 Fibromyalgie.- 14.2.2 Chronisches Erschöpfungssyndrom.- 14.3 Diagnostik.- 14.4 Ätiologiemodelle.- 14.4.1 Neuroendokrine Dysfunktionen.- 14.4.2 Kognitiv-behaviorales Ätiologiemodell.- 14.4.3 Psychoneuroendokrinologisches Ätiologiemodell.- 14.5 Therapie.- 14.5.1 Kognitiv-verhaltenstherapeutisches Vorgehen.- Zusammenfassung, Wiederholungsfragen und Literatur.- 15 Adipositas.- 15.1 Epidemiologie und Verlauf.- 15.2 Beschreibung der Störung.- 15.2.1 Definition und Klassifikation.- 15.2.2 Medizinische Konsequenzen.- 15.2.3 Psychosoziale Konsequenzen.- 15.2.4 Essverhalten und Kalorienaufnahme.- 15.3 Bedingungsfaktoren.- 15.3.1 Genetische Faktoren.- 15.3.2 Kalorienverbrauch und Stoffwechsel.- 15.3.3 Psychologische und psychosoziale Einflussfaktoren.- 15.3.4 Biopsychosoziales Modell.- 15.4 Interventionsansätze.- 15.4.1 Ernährungsmanagement.- 15.4.2 Sport.- 15.4.3 Verhaltenstherapeutische Verfahren.- 15.4.4 Medikamentöse Therapie.- 15.4.5 Operative Methoden.- 15.4.6 Multimodale Programme.- 15.4.7 Bewertung zum Langzeit-Outcome.- 15.5 Fallbeispiel zur Diagnostik und multimodalen Therapie.- 15.6 Ausblick.- Zusammenfassung, Wiederholungsfragen und Literatur.- 16 Diabetes mellitus.- 16.1 Diabetes mellitus als chronische Erkrankung: Medizinische und psychologische Grundlagen.- 16.1.1 Klassifikation, Epidemiologie und Diagnostik.- 16.1.2 Therapie.- 16.1.3 Bedeutung der Verhaltenswissenschaften für die optimale Behandlung des Diabetes mellitus.- 16.2 Selbstmanagement: Diabetes als Modellkrankheit der Verhaltensmedizin.- 16.2.1 Determinanten von Selbstmanagement.- 16.2.2 Interventionen zur Verbesserung des Selbstmanagements.- 16.2.3 Kinder und Jugendliche mit Diabetes.- 16.3 Spezielle Fragen in der Behandlung des Diabetes.- 16.3.1 Komorbide psychische Störungen: Depressionen, Essstörungen, Ängste.- 16.3.2 Training zur Verbesserung der Hypoglykämie-Wahrnehmung.- 16.3.3 Diabetes mellitus im Internet.- Zusammenfassung, Wiederholungsfragen und Literatur.- 17 Tinnitus.- 17.1 Definition und Beschreibung des Störungsbildes.- 17.2 Epidemiologie.- 17.3 Entstehung und Aufrechterhaltung von Tinnitus.- 17.4 Chronischer Tinnitus als Störungssyndrom.- 17.5 Psychophysiologisches Modell des chronischen Tinnitus-Syndroms.- 17.6 Möglichkeiten der medizinischen Behandlung.- 17.7 Psychologische Diagnostik und Therapie des chronischen Tinnitus-Syndroms.- 17.7.1 Diagnostik und Therapieevaluation.- 17.7.2 Psychologische Therapieansätze.- Zusammenfassung, Wiederholungsfragen und Literatur.- 18 Neurologische Erkrankungen.- 18.1 Definition, Klassifikation und klinische Beschreibungen.- 18.2 Epidemiologie, Verlauf und Komorbidität.- 18.3 Ätiologische Konzepte.- 18.3.1 Das Modell des stimulusgesteuerten Problemverhaltens.- 18.3.2 Das Modell operant gesteuerter Überschusssymptome.- 18.3.3 Das Modell defizitärer Selbstregulation.- 18.3.4 Das Modell des „learned non-use“.- 18.3.5 Verhaltensprobleme durch schwere neurologische Defizite.- 18.3.6 Das Modell minimaler neuropsychologischer Defizite.- 18.3.7 Das Modell der Anpassungsstörungen.- 18.4 Diagnostische Methoden.- 18.5 Therapie und Effektivitätsnachweise.- 18.5.1 Die Therapie stimulusgesteuerten Problemverhaltens.- 18.5.2 Die Therapie operant gelernten Problemverhaltens..- 18.5.3 Verhaltensmedizinische Maßnahmen zur Erhöhung der Selbstregulation.- 18.5.4 Die verhaltensmedizinische Behandlung des „learned non-use“.- 18.5.5 Verhaltensmedizinische Interventionen bei schweren neurologischen Defiziten.- 18.5.6 Verhaltensmedizinische Therapie minimaler neuropsychologischer Defizite.- 18.5.7 Psychologische Interventionen bei Angehörigen neurologischer Patienten.- Zusammenfassung, Wiederholungsfragen und Literatur.- Epilog.
PRODUCT DETAILS
Publisher: Springer (Springer Berlin Heidelberg)
Publication date: August, 2012
Pages: 635
Weight: 1275g
Availability: Not available (reason unspecified)
Subcategories: General Practice, Psychology
From the same series
Wolfram Karges
Georg Lc6ffler
Hermann Lang
Ulrike Ehlert
Mihai Ancau
Werner Hacke
Werner Buselmaier
Marian C. Poetzsch
Theo R Payk
Gerald Rimbach
Jürgen Schatz
Manfred Gey
Thomas Gasser
E Hackenthal
Mary Anne Koda-Kimble
Thomas Luescher
Elke Wild
Ulrich Harten
David G. Myers
Tina Hartmann
Klaus Windgassen
Marcel Verhoff
Thomas Ziegenfuß
Jasmin Webinger
Wolfgang Stroebe
Mark Buchta
D. Ladewig
Gerhard Heldmaier
Robert F. Schmidt
Jürgen E. Gschwend
Peter C Heinrich
Wolfram Karges
J. Crocker
Thomas Lüscher
Martin W. Schnell
Adalbert Wollrab
Thomas Luescher
Michael P. Manns
Stefan H. E. Kaufmann
Alexander Krämer
Peter Berlit
Steffen Fleßa
Xaver Baur
Berthold Rzany
Wolfgang Uwe Eckart
Veronika Brandstätter
Joachim Hoffmann
Joachim Grifka
Berthold Koletzko
Wolfgang Piper
Johannes Zschocke
Tilman Grune
Peter Zweifel
Franz Petermann
Robert F. Schmidt
Ulrich Hagg-Grun
Gerhard Heldmaier
M. Ackenheil
Herbert Stricker
Matthias Berking
Matthias Berking
Werner A Muller
Jorg-Rudiger Siewert
Hans-Otto Karnath
Thomas Lenarz
Werner Buselmaier
Stefan H. E. Kaufmann
Stefan Offermanns
Manfred Amelang
Christian Prinz
Rudolf Klussmann
Fritz K. Beller
Michael Jacobs
Helmut Kindl
Norbert Pallua
Peter Kappeler
Klaus Windgassen
Jürgen Schatz
Nicolai Maass
Peter Walter
Thomas Ziegenfuß
Franz Grehn
Werner Baltes
Rainer Muche
Thomas Gasser
Hans-Ulrich Wittchen
Marcel Verhoff
Christian Reimer
Helmut Klein
Barbel Hacker
Ulrich Harten
Johannes C.G. Ottow
Barbel Hacker
Thomas Lüscher
Jörg B. Schulz
Florian Lang
J.-Matthias Graf von der Schulenburg
Werner Hacke
Jorg-Rudiger Siewert
Hermann Lang
Karl Zilles
Theo R Payk
Wolfgang Hennig
Ulrike Leopold-Wildburger
Richard Hautmann
Gerald Rimbach
Kay Brune
Berthold Koletzko
Norbert Wagner
Stephan Frings
Bernhard Tillmann
Frank Schneider
Gerold Adam
Bernhard Tillmann
Peter Fritsch
Ursus-Nikolaus Riede
Franz-Josef Kretz
Manfred Gey
Hans Peter Latscha
Klaus-Peter W. Schaps
Klaus-Peter W. Schaps
Georg Loffler
Klaus-Peter W. Schaps
Klaus-Peter W. Schaps
Jurgen Bortz
Brigitte Frank
Klaus-Peter W. Schaps
Jürgen Neumann
Klaus-Peter W. Schaps
Josef Rosenecker
Werner Grosch
Klaus-Peter W. Schaps
Ulrich Kattmann
Klaus-Peter W. Schaps
Rolf D. Issels
Klaus-Peter W. Schaps
Christian Hick
Stefan Gr]ne
Nanny Wermuth
Marc Naguib
Walter Jonat
Thomas Efferth
Arnulf Moeller